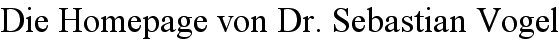Aus: Richard Dawkins, Geschichten vom Ursprung des Lebens: Eine Zeitreise auf Darwins Spuren. Berlin: Ullstein 2008, ISBN 978-3-550-08748-6. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlages.
Die Geschichte des Schnabeltiers
Ein alter wissenschaftlicher Name für das Schnabeltier lautete Ornithorhynchus paradoxus. Als man es entdeckte, wirkte es äußerst seltsam, und ein Exemplar, das an ein Museum geschickt wurde, hielt man zunächst für eine Fälschung: Man glaubte, jemand habe Teile von Säugetier und Vogel zusammengenäht. Andere fragten sich, ob Gott vielleicht einen schlechten Tag hatte, als er das Schnabeltier erschuf. Vielleicht hatte er ja auf dem Fußboden seiner Werkstatt ein paar überzählige Teile gefunden und sich entschlossen, sie nicht zu verschwenden, sondern zu verbinden. Noch heimtückischer (weil sie es ernst meinten) waren Zoologen, die den Kloakentieren das Etikett "primitiv" aufdrückten, als sei primitiv herumsitzen eine Lebensaufgabe. Die Geschichte des Schnabeltiers soll diese Vorstellung hinterfragen.
Seit dem Mitfahren 15 hatten die Schnabeltiere für ihre weitere Evolution genauso viel Zeit wie alle übrigen Säugetiere. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass eine Gruppe primitiver sein sollte als die andere (wie gesagt: "primitiv" bedeutet nichts anderes als "dem Vorfahren ähnlich"). Die Kloakentiere mögen in mancher Hinsicht primitiver sein als wir, beispielsweise weil sie Eier legen. Aber es gibt keinen Grund, warum Primitivität in einem Aspekt automatisch Primitivität in einem anderen nach sich ziehen sollte. Es gibt keine "Altertümlichkeitsessenz", die sich im Blut verteilt und von den Knochen aufgesogen wird. Ein primitiver Knochen ist ein Knochen, der sich seit langer Zeit nicht verändert hat. Kein Gesetz besagt, dass deshalb auch der Nachbarknochen primitiv sein muss oder dass auch nur die geringste derartige Tendenz dazu besteht - zumindest so lange, bis nicht wiederum irgendetwas dafür spricht. Dies kann man sich nicht besser klarmachen als am Schnabel der Schnabeltiere selbst. Er ist in der Evolution weit gekommen, auch wenn dies für andere Teile des Schnabeltiers vielleicht nicht gilt.
Der Schnabel der Schnabeltiere mag komisch aussehen, zumal seine Ähnlichkeit mit einem Entenschnabel dadurch verstärkt wird, dass er relativ groß ist, und außerdem wirkt ein Schnabel schon von sich aus in gewisser Weise lächerlich - vielleicht weil er uns an Donald Duck erinnert. Aber mit Humor wird man diesem großartigen Apparat nicht gerecht. Wenn man schon an ein unpassend verpflanztes Teil denken will, sollte man die Enten ganz schnell vergessen. Ein aufschlussreicherer Vergleichsgegenstand ist die zusätzliche Nase, die den Nimrod-Aufklärungsflugzeugen aufgepflanzt wurde. Das amerikanische Gegenstück heißt AWACS - es ist bekannter, eignet sich für meinen Vergleich aber weniger gut, weil das "aufgepflanzte" Teil sich bei den AWACS-Maschinen nicht wie ein Schnabel am Bug, sondern oben auf dem Rumpf befindet.
Entscheidend ist, dass es sich beim Schnabel des Schnabeltiers, anders als bei einer Ente, nicht nur um zwei Kiefer zum Gründeln und Fressen handelt. Diese Funktionen erfüllt er ebenfalls, allerdings ist er nicht verhornt wie ein Entenschnabel, sondern eher gummiähnlich. Viel interessanter ist aber etwas anderes: Der Schnabel des Schnabeltiers ist ein Aufklärungsinstrument, ein AWACS-Organ. Schnabeltiere machen Jagd auf Krebse, Insektenlarven und andere kleine Tiere, die sich im Schlamm am Boden von Wasserläufen verstecken. Augen sind dort keine große Hilfe - das Schnabeltier hält sie fest geschlossen, wenn es auf die Jagd geht. Und das ist noch nicht alles: Es verschließt auch Nasenöffnungen und Ohren. Es sieht die Beute nicht, es hört die Beute nicht, es riecht die Beute nicht, und doch findet es sie mit großer Zielsicherheit: An einem einzigen Tag stöbert es so viele Beutetiere auf, wie es der Hälfte seines eigenen Körpergewichts entspricht.
Angenommen, wir wären skeptische Wissenschaftler und wollten jemanden auf die Probe stellen, der von sich behauptet, er habe einen "sechsten Sinn". Was würden wir tun? Wir würden ihm die Augen verbinden, die Ohren verstopfen und die Nase verschließen, und ihm dann eine Aufgabe stellen, die nur mit Sinneswahrnehmung zu lösen ist. Die Schnabeltiere geben sich alle Mühe, uns dieses Experiment abzunehmen. Sie schalten drei Sinne aus, die für uns (und vielleicht auch für sie, wenn sie sich an Land befinden) wichtig sind, als wollten sie sich ganz auf eine vierte Form der Wahrnehmung konzentrieren. Den entscheidenden Hinweis liefert uns ein weiterer Aspekt ihres Jagdverhaltens. Sie schwingen den Schnabel beim Schwimmen hin und her - Bewegungen, die man auch Sakkaden nennt. Es sieht aus wie eine Radarantenne, die den Himmel absucht...
...
Wenn ein Tier - beispielsweise ein Süßwasserkrebs, eine typische Beute für für das Schnabeltier - seine Muskeln bewegt, entstehen zwangsläufig schwache elektrische Felder. Diese lassen sich insbesondere im Wasser mit einem ausreichend empfindlichen Sinnesapparat wahrnehmen. Setzt man eine größere Anordnung solcher Sensoren und ausreichende Computer-Rechenleistung ein, kann man aus den Daten den Ausgangspunkt des elektrischen Feldes berechnen. Natürlich rechnen Schnabeltiere nicht so, wie ein Mathematiker oder ein Computer es tun würde. Aber auf irgendeiner Ebene in ihrem Gehirn findet etwas Entsprechendes statt, und das hat zur Folge, dass sie ihre Beute fangen.
Beim Schnabeltier verteilen sich über beide Seiten des Schnabels ungefähr 40.000 in Längsstreifen angeordnete elektrische Sensoren. Wie man an dem [zuvor erläuterten] Schnabeltierunculus erkennt, ist ein großer Teil des Gehirns der Aufgabe gewidmet, die Daten dieser 40.000 Sensoren zu verarbeiten. Aber es kommt noch besser. Neben den 40.000 elektrischen Sensoren gibt es ungefähr 60.000 mechanische "Druckstäbchen" auf der Schnabeloberfläche . Wie Pettigrew und seine Mitarbeiter feststellten, werden die Informationen dieser mechanischen Sensoren von speziellen Nervenzellen im Gehirn aufgenommen. Andere Gehirnzellen sprechen sowohl auf Signale von den elektrischen als auch den mechanischen Sensoren an (Gehirnzellen, die ausschließlich von den elektrischen Sensoren angeregt werden, haben sie bisher nicht gefunden). Die Zellen beider Typen nehmen auf der räumlichen Landkarte des Schnabels die richtigen Positionen ein und bilden Schichten; die Anordnung erinnert an das Sehzentrum im Gehirn des Menschen, dessen verschiedene Schichten das räumliche Sehen ermöglichen. Wie unser in Schichten aufgebautes Gehirn, das die Informationen der beiden Augen zusammenführt und daraus ein räumliches Bild aufbaut, so nutzt auch das Schnabeltiergehirn nach den Vermutungen von Pettigrews Arbeitsgruppe die Informationen der elektrischen und mechanischen Sensoren. Wie funktioniert das?
Als Analogie schlagen sie Donner und Blitz vor. Das Zucken des Blitzes und das Krachen des Donners entstehen im gleichen Augenblick. Den Blitz sehen wir sofort, aber bis der Donner uns erreicht, dauert es länger, weil er sich mit der relativ langsamen Schallgeschwindigkeit bewegt (wobei das Knallen übrigens durch verschiedene Echos zu einem Rumpeln wird). Wenn wir den zeitlichen Abstand zwischen Blitz und Donner messen, können wir berechnen, wie weit das Gewitter entfernt ist. Vielleicht sind die elektrischen Entladungen aus den Muskeln der Beute für das Schnabeltier der Blitz, und der Donner sind die Wasserwellen, die das Beutetier mit seinen Bewegungen verursacht. Ist das Gehirn des Schnabeltiers so eingerichtet, dass es den zeitlichen Abstand zwischen beiden Reizen registriert und daraus berechnet, wie weit das Beutetier entfernt ist? Es sieht ganz danach aus.
Um herauszufinden, wo genau sich die Beute befindet, muss das Schnabeltier die Signale verschiedener Rezeptoren aus dem gesamten Bereich der Landkarte vergleichen; dabei helfen ihm vermutlich die seitlichen Suchbewegungen des Schnabels, ganz ähnlich wie die Rotation der Antenne eines von Menschen gemachten Radars. Mit einer Anordnung aus derart vielen Sensoren, die ihre Informationen an eine landkartenähnliche Anordnung von Gehirnzellen weitergeben, kann das Schnabeltier vermutlich ein sehr genaues dreidimensionales Bild aller elektrischen Vorgänge in seiner Umgebung aufbauen.